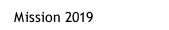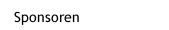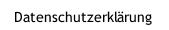|
Praktikumsbericht- Ouagadougou 2019 Das erste Mal, dass ich von OHA! gehört habe, war zu meiner Schulzeit. Meine ehemalige Schule, die NAO, unterstützt die Organisation schon etwas länger mit Benefizkonzerten, sodass ich Etienne schon mehrmals über die Methodik und Ziele von OHA! habe reden hören. Aber trotzdem erschien mir Burkina Faso und die Missionen sehr weit weg und ich hätte mir auch nie vorstellen können, jemals irgendwie weiter damit in Kontakt zu geraten. Aber kurz vor Silvester erhielt ich eine Email von meinem ehemaligen Musik-LK-Lehrer. Darin stand, dass für die Mission im Februar noch ein Platz für ein zweiwöchiges Praktikum zu vergeben sei. Also habe ich noch am selben Abend eine Mail an Etienne geschickt, in der ich ihm ungefähr meine Situation schilderte: Ich bin in meinem ersten Ausbildungsjahr zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in den HSK in Wiesbaden und würde gerne ein Praktikum mit einem eher medizinischen Schwerpunkt machen. Außen vor gelassen habe ich dabei unter anderem, dass ich noch nicht achtzehn war, noch nie auch nur einen Zeh aus Europa rausgestreckt habe und ergo auch nicht im Besitz eines Reisepasses war. Zu dem Zeitpunkt war die Reise für mich aber auch noch sehr theoretisch und als ich die Tage darauf nichts von Etienne hörte, geriet das Ganze ein Bisschen in Vergessenheit. Dann kam allerdings eine Antwortmail, in der Etienne schrieb, dass ich mich zwar schnell um Visum und Co kümmern müsste, der Rest aber kein Problem sein sollte. Da kamen erstmal Zweifel auf. Ich war mir bewusst gewesen, um was ich mich beworben hatte, aber ich hatte keine Erfahrung im OP, keinen Reisepass, Französisch (die dortige Amtssprache) hatte ich in der Q1 abgewählt und ich wusste noch nicht mal, ob ich so kurzfristig Urlaub kriegen würde. Und jetzt würde ich mit sechs Personen, die ich, außer Etienne, noch nie gesehen hatte in ein völlig fremdes Land fliegen um dort bei Hüft-OP`s zuzuschauen. Ich war kurz davor, doch abzusagen. Aber da war die Neugier, etwas zu erleben, was man sich gar nicht vorstellen kann, eine Gesellschaft kennenzulernen, die der deutschen nicht unterschiedlicher sein könnte und das Interesse an den OPs. Also habe ich mich erstmal hingesetzt, um zwei Wochen Urlaub, einen Reisepass, Impfungen, Malariaprophylaxe, den Flug und ein Visum zu bekommen. Und so kam es dann, dass ich am 9.2 um sechs Uhr mit meinen sieben Sachen zu Dr. Christoph Meister und seiner Tochter Laya, die auch als Praktikantin mitkam, gefahren bin, um mir mit ihnen ein Taxi zum Frankfurter Flughafen zu teilen. Dort lernte ich dann auch die meisten anderen Teilnehmer kennen. Während dem Flug hatte ich dann das große Glück, dass meine Kamera leider den Geist aufgab, was auch der Grund dafür ist, dass der Praktikumsbericht leider nicht mit Fotos unterlegt ist. Die Flüge waren verhältnismäßig schnell vorbei, sodass es ein ziemlicher Kulturschock war, in Ouagadougou aus dem Flugzeug zu steigen. Da gab es die offensichtlichen Unterschiede wie das Klima, den Zustand der Gebäude und die Hautfarbe der meisten Bewohner. Aber auch Dinge wie das Miteinander unter den Menschen waren anders. Auf mich wirkten die Leute, auch wenn man sich nicht kannte, viel distanzloser. Das war meist positiv, wenn jeder total offen, hilfsbereit und kommunikativ einfach auf einen zukommt, manchmal war es aber auch so ungewohnt, dass es für mich unangenehm war. Auf dem Weg zum Hotel bekam ich dann einen ersten Eindruck von der Stadt und ihren Einwohnern. Das Karité bleu, das Hotel in dem wir wohnten, erschien in den staubigen, trockenen Straßen und der drückenden Hitze wie eine Oase aus Tausendundeine Nacht. Das lag wahrscheinlich daran, dass dort dreimal am Tag alle bewässert wurde, um die heimelige Tropenatmosphäre aufrecht zu erhalten. Nach der langen Reise gab es dann Abendessen, danach war ich dann auch so müde, dass ich mit Laya, mit der ich mir ein Zimmer geteilt habe erst vor den latent aggressiven Hauskranichen geflüchtet bin und dann ins Bett fiel. Am nächsten Morgen wurden wir nach dem Frühstück von Justin, dem Fahrer der Klinik zum Krankenhaus gebracht. Dort gab es erst mal etliche Vorstellungen, vor denen es mir eigentlich sonst graust. Aber wieder waren die Menschen dort so höflich und ungezwungen, dass ich mich schnell wohl gefühlt habe. Als ich das Innere des OP-Blocks zu Gesicht bekam, hat mich der Anblick erst mal zum Nachdenken gebracht. Nicht nur das was da war (Staub, tropfende Klimaanlagen, …), sondern auch das, was nicht da war. In Deutschland hätte wahrscheinlich der Patient und das OP-Personal auf dem Absatz kehrtgemacht, von der Hygieneabteilung ganz zu schweigen. Aber hier war das normal, damit wird so gut es geht gearbeitet. Als ich Etienne fragte, ob unter diesen Umständen mehr postoperative Komplikationen aufträten, meinte er, dass die OPs im Gegenteil keine höhere Infektionsrate aufzeigen würden. Das fand sehr erstaunlich. Anschließend begannen die Ärzte mit den Sprechstunden, während wir anderen die Materialien auspackten und einsortierten. Dabei habe ich versucht, so gut wie möglich mitzuhelfen, aber ich habe schnell gemerkt, dass es eine gewisse Routine im Team gibt. Schließlich geht die Mission nur zwei Wochen, da will man nicht unnötig Zeit verschwenden. Da ich dort dann keine große Hilfe war und auch eher im Weg herumstand beschlossen Laya und ich, uns die Sprechstunden von Etienne, Christoph und Eustache anzuschauen. Dort bekam dann der Begriff „Patienten“ plötzlich ganz viele verschiedene Gesichter, von denen die meisten erschreckend jung waren. Besonders in Erinnerung blieben zum Beispiel eine Vierzehnjährige mit beidseitiger Hüftarthrose und eine junge Frau mit einem, für ein ungeschultes Auge wie meinem, riesigen Längenunterschied in den Beinen. Beide wurden nicht operiert, unter anderem aus dem Grund, dass die Prothesen durchschnittlich nur ca. 15 Jahre halten, bei jungen Menschen müsste die Prothesen dementsprechend häufig gewechselt werden. Es gab auch einige Patienten, bei denen beide Hüftgelenke schon so kaputt waren, dass die Ärzte nach einem Blick auf die Röntgenbilder beschlossen, die eine Hüfte am Anfang der Mission zu operieren und die andere am Ende. Am Abend ging es dann wieder ins Hotel zurück. An meinem zweiten Tag sollte eigentlich der zweite Teil der Materialien am Flughafen ankommen, als allerdings nach vier Stunden immer noch keine Ladung in Sicht war blieben ein paar Leute vom Team noch in der Klinik, wir anderen sind stattdessen ins „Village Artisanal“ gefahren, ein Kunsthandwerker- Zentrum. Dort gab es ein paar schöne Kleinigkeiten und man konnte den Künstlern manchmal bei der Arbeit zusehen, allerdings war es recht touristisch aufgezogen. Am 13.2 ging es dann endlich mit den ersten OPs los. Als der erste Patient auf dem Tisch lag war es schon aufregend für mich, auch wenn ich nur zuschauend dasaß. Vorher war ich im Laufe meiner Ausbildung erst einmal im OP gewesen und zwar bei einer Augen-OP. Dort hatte dann der Chirurg einen millimeterlangen Schnitt gemacht, dann ein winzig kleines Instrument einen halben Zentimeter nach vorne geschoben usw. Die Hüft-OP´s waren dann doch etwas anders. Dort geht es viel kraftvoller, bewegter und vor allem lauter zu. Dabei sollte ich vielleicht auch hinzufügen, dass die Patienten dort aus Mangel an Equipment keine Vollnarkose, sondern eine spinale Anästhesie bekommen. Diese sorgt natürlich dafür, dass der Patient keine Schmerzen hat. Ansonsten ist er aber meist bei Bewusstsein und bemerkt dementsprechend, was in ihm vor sich geht. Nachdem ich an dem Tag bei drei verschiedenen Operationen zuschauen konnte ( es wird in zwei Räumen gleichzeitig operiert) waren um 20 Uhr alle fertig und auch an dem Tag bin ich wieder ins Bett gefallen, auch zuschauen und aufpassen kann ziemlich müde machen. Die nächsten Tage verliefen dann alle ähnlich dem ersten. Ich habe auch, nach dem ich das anfängliche Staunen überwunden hatte, andere Dinge zu bemerken, sodass ich zum Beispiel anfing, die Abläufe zu verinnerlichen. Außerdem offenbarten sich auch die unterschiedlichsten Schwierigkeiten. Ob nun die tropfende Klimaanlage, bestimmte Prothesenteile, die es nicht so häufig gab oder Stromausfälle, die zu einem dunklen OP und manchmal auch fehlgeschlagenen Sterilisationen führten, die wiederum mal kürze und mal längere Verzögerungen mit sich brachten. Am 16.2 gab es dann eine kleine Veränderung, denn bei der ersten OP, ein Patient, bei dem die vor fünf Jahren eingesetzte Hüftpfanne verrutscht war, operierte sowohl Christoph als auch Etienne. Die Operation verlief ein wenig komplizierter als die vorherigen und als irgendwann der Blutdruck soweit fiel, dass zwei Bluttransfusionen angehängt werden mussten, wurde mir die Ernsthaftigkeit der Lage erst bewusst. Alle OPs waren gut gelaufen, aber mir wurde dann klar, dass, wenn etwas ganz schiefgelaufen wäre, dann hätte es zu der Situation kommen können, dass dem Patienten in zum Beispiel Deutschland viel besser hätte geholfen werden können, während ihm in einem so armen Land wie Burkina Faso ebendiese Hilfe verwehrt bleiben würde. Und das kam mir so unsinnig und unverständlich vor, dass dort Menschenleben von so banalen Dingen wie Geld abhängig sind. Wenn ich dort das Gesundheitssystem und die medizinische Versorgungsmöglichkeiten mit denen in Deutschland verglich habe ich mich schon fast geschämt für den Überfluss, den ich im deutschen Krankenhaus gewohnt bin. Nach der OP, die noch ein gutes Ende genommen hat, ging ich dann zum ersten Mal mit auf die postoperative Visite. Dabei fiel mir gleich auf, was für einen riesigen Anteil der Pflege dort die Familie übernimmt. Wenn ein Angehöriger im Krankenhaus lag, kam der Rest der Familie und sorgte unteranderem für die Verpflegung und die Körperwäsche. Da zeigt sich auch wieder das distanzlose Miteinander, das in deutschen Kliniken doch eher selten ist. Die Aufgaben der Krankenpfleger waren dort Dinge wie Wundversorgung und Verbandswechsel, auch dabei durfte ich mehrmals zuschauen. Erstaunlich fand ich vor allem, wie schnell die Patienten nach der OP wieder mobil wurden. In Erinnerung blieb mir vor allem eine junge Frau, die, als die Visite kam, noch überhaupt nicht versucht hatte, zu laufen, aus Angst vor Stürzen und Schmerzen. Also wurde sie vorsichtig auf beide Beine gestellt und die ersten Schritte ging sie mit Etienne. Danach erklärte er ihr, wie sie mit den Krücken laufen solle. Als wir am Ende der Visite an ihrem Zimmer vorbeikamen trafen wir sie an, als sie den Flur vor dem Zimmer auf und ab lief. Sobald sie ihre ersten Ängste überwunden hatte, war sie Feuer und Flamme, wieder schmerzfrei laufen zu können, man merkte ihr an, wieviel ihr ihre Mobilität bedeutete. Es war ein sehr schönes Erlebnis, diese Veränderung im Leben eines Menschen beobachten zu dürfen. Dienstag, der 19.2 verläuft tagsüber wie die Tage zuvor, abends findet aber ein Essen mit der Klinikleitung statt. Wir saßen alle um einen großen Tisch und stellten uns vor. Danach folgte das Essen, unterbrochen von zahlreichen Reden, bei denen betont wurde, wie wichtig die Zusammenarbeit, ob nun generell zwischen den Ländern oder im Missionsteam und im Krankenhaus ist, um ein einwandfreies Funktionieren der Mission sicherzustellen. Insgesamt wurde an dem Abend ziemlich viel geredet und erzählt und auch ich habe mich eine Weile mit meinem Sitznachbarn unterhalten, wobei mir auffiel, dass sich während meines doch recht kurzen Aufenthalts dort mein Französisch ein bisschen verbessert hatte, noch etwas, was ich aus Afrika mit zurückgenommen habe. Den nächsten Tag haben Laya und ich dann genutzt, um uns ein wenig in der Umgebung des Hotels umzuschauen. Wir brachen also zugegeben ein wenig planlos auf und stießen schon bald auf zahlreiche kleine Marktstände, an denen vor allem Lebensmittel angeboten wurden. Aber Laya wollte eigentlich ein Kleid kaufen, also gingen wir in zwei verschiedene Läden rein. Der erste Ladenbesitzer war natürlich darauf bedacht, uns etwas zu verkaufen. Aber er war nicht zu aufdringlich und merkte, wenn uns seine Angebote etwas unangenehm wurden. Mit ihm habe ich mich auch sehr nett unterhalten während Laya ein Kleid anprobierte. Als wir nichts kauften blieb er höflich und professionell. Es war eine entspannte Einkaufserfahrung gewesen und es war auch mal schön, sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht aus dem Krankenhaus war. Beim zweiten Laden lief es ein bisschen anders. Schon beim Eintreten wurde Laya ein Kleid in die Hand gedrückt, während ich mich mit zwei jungen Männern unterhielt, die dort saßen. Das Gespräch mit ihnen war ziemlich seltsam. Ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass sie sich eher über uns lustig machten als sich ernsthaft zu unterhalten. Wir mussten sehr entschieden ablehnen, wenn wir nicht mit einer Menge unnützer Dinge den Laden verlassen wollten. Auf dem Rückweg zum Hotel war ich ein bisschen erleichtert. Auch am nächsten Tag waren wir wieder in der Stadt unterwegs, diesmal ging es mit etwas größerer Gruppe zum Nationalmuseum. Ich muss gestehen ich hatte es mir ein wenig anders vorgestellt. Uns erwarteten insgesamt zwei Ausstellungssäle. Im ersten wurde das Thema Musikträger und Musikproduktion behandelt, was ich nicht so interessant fand. Im zweiten Saal wurden traditionelle Masken ausgestellt, zu denen die Museumsführerin einiges zu erzählen wusste. Das war viel interessanter und ich hätte sehr gerne noch mehr über die Geschichte und Traditionen des Landes gelernt. Der Rest des Tages war unverplant, was auch sehr schön war. Ich habe währenddessen zum Beispiel Rommé gelernt, gespielt und verloren. Am letzten freien Tag wollten wir die Gelegenheit nutzen und mal aus Ouagadougou raus fahren um die ländliche Seite von Burkina Faso zu sehen. Wir entschieden uns für das Operndorf. Um es kurz für diejenigen zusammenzufassen, die noch nie etwas vom Operndorf gehört haben: Nach seiner Krebsdiagnose nutzte Christoph Schlingensief, ein deutscher Künstler und Regisseur, seine verbleibende Zeit um ein Operndorf in der Wüste zu errichten. In dem Dorf sollten Menschen jeglicher Herkunft die Möglichkeit haben, sich kreativ auszutauschen. Aber was ist eine Oper ohne Menschen? Und wie schafft man es, ein Projekt wie dieses mitten in der Wüste Burkina Fasos am Leben zu erhalten? Also entschloss er sich, in der Mitte von drei Dörfern das Projekt mit einer Grundschule und einer Krankenstation zu beginnen. Als wir dort ankamen war wohl gerade Pause, denn zwischen den Schulgebäuden saßen eine Menge Kinder verschiedener Altersgruppen. Und wenn ich sie mit den Kindern, die ich in Ouagadougou beobachten konnte verglich, hatte man das Gefühl, dass sie hier nicht so schnell erwachsen werden mussten. Sie wirkten nicht so ernst und beherrscht, sondern eher neugierig und schüchtern. Auch die Architektur der Gebäude war interessant, aber was das Projekt für die Menschen dort bedeutete war für mich viel interessanter. Denn es hat mir bewusst gemacht, dass jeder Mensch mit Idealen etwas Großes bewirken kann. Selbst etwas, was so absurd klingt wie eine Oper mitten in der Wüste. Diese Erfahrung finde ich unglaublich wertvoll und ich würde mir wünschen, dass sie jeder einmal machen würde. Neben dem Operndorf befand sich außerdem ein Skulpturenpark. Natürlicherweise liegen dort große Granitblöcke, aus denen Künstler aus aller Welt Skulpturen hauen. Manche sind ganz auf Ästhetik ausgerichtet, die meisten verkörpern aber entweder die Seele und Geschichte des Landes oder sie sind sozialkritische Verbildlichungen, ob nun für Meinungsfreiheit, Demokratie oder gegen Sklaverei. Die Skulpturen waren meist wunderschön gearbeitet und der Guide wusste eine Menge zu erzählen. Allerdings waren wir im Freien auch der prallen Mittagshitze ausgesetzt, sodass es mir leider schwerfiel, mich zu konzentrieren. Das war sehr schade, denn dort hätte ich das lernen können, was mir im Nationalmuseum gefehlt hatte. Am Abreisetag packten wir in der Klinik alle Materialien zusammen, die zurück nach Deutschland geschickt werden mussten. Danach wurden alle Sitzgelegenheiten im OP-Trakt zusammengesucht und es gab nochmal ein letztes gemeinsames Mittagessen. Dann verabschiedeten wir uns auch schon von allen Mitarbeitern. Am Abend sind wir zurückgeflogen und natürlich habe ich mich auch ein bisschen auf Zuhause gefreut. Meine Erwartungen an das Praktikum waren gewesen, einen Einblick in ein fremdes Land, in den OP und andere Bedingungen zu kriegen. All das wurde erfüllt. Aber ich hatte nicht damit gerechnet, wie sehr sich mein Denken und auch meine Prioritäten verschieben würden. Die Reise hat mich verändert und dabei meine Erwartungen weit übertroffen. Das gute Gefühl, dass einen überkommt, wenn man gemeinsam etwas für andere erreichen kann hat mich nachhaltig beeindruckt. Die Fremdartigkeit der Stadt und die Vielzahl an neuen Erlebnissen, die damit einhergingen hat meine Reiselust geweckt. Und das Team von OHA! hat mich motiviert, Ideen und Träume ernst zu nehmen und auch mal was zu wagen. Ich bedanke mich herzlichst bei allen aus dem Team und insbesondere bei Etienne für die Ermöglichung dieser unglaublichen Erfahrung. Vielen Dank. Emma Luise Vorhauer, 15.03.2019 |